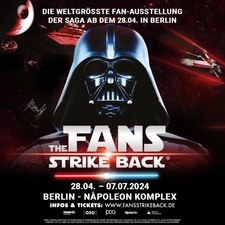Pitch Poetics: Die Moderation von Fußballspielen als Oraltur
Das sagt der/die Veranstalter:in:
Die Geschichten von Radio und Sport sind seit jeher eng miteinander verknüpft, insbesondere seit Beginn der Übertragung von Spielen in Echtzeit in den 1920er Jahren. Dies markierte die Abkehr von der telefonischen Meldung von Ergebnissen und eröffnete die Möglichkeit, ein breiteres Publikum zu erreichen, indem regelmäßige Hörer*innen – insbesondere Fußballfans – durch Live-Berichterstattung an den Sport herangeführt wurden. Die Moderation von Fußballspielen verwischt in der Regel die Grenzen zwischen Unterhaltung und journalistischem Diskurs, einige Kommentator*innen jedoch gingen noch einen Schritt weiter und bedienten sich bei Mitteln der literarischen Erzählung, um ihrer Analyse Tiefe und Poesie zu verleihen und bestimmte Momente der Fußballgeschichte zu verewigen. Diese Kommentator*innen verwenden Sprache, um die kontinuierlichen Veränderungen des Spiels anschaulich zu beschreiben und setzen dabei – ähnlich zur Oraltur – vergleichbare literarische Techniken ein, um ein dynamisches und eindringliches Erlebnis zu schaffen, das die Aufregung, die Dramatik und die Nuancen des Spiels vermittelt.
In seinem Essay „The Poetry of Soccer Commentary“ beklagt James Yékú den Niedergang der Verwendung literarischer Techniken in der zeitgenössischen Moderation von Fußballspielen und hebt hervor, was durch diese Vorgehensweise von Kommentator*innen wie Ernest Okonkwo und Peter Drury ermöglicht wird. Er schreibt:
Während Okonkwo aus Nigeria für seine Neigung berühmt war, Spieler*innen nach ihren Eigenschaften auf dem Spielfeld zu benennen – zum Beispiel „langsames Gift“ (Idowu Otubusen), „elastisch“ (Elahor), „der Größte“ (Emmanuel Okala), „Vorsitzender“ (Christian Chukwu), „Raupe“ (Kelechi Emetole) und „Quecksilber“ (Sylvanus Okpala) –, handelt es sich bei Drury um den Meister analoger Nomenklaturen. Als Pep Guardiola einst in einem EPL-Spiel Gabriel Jesus für David Silva einwechselte, meinte Drury: „Jesus für Silva: ein Schachzug, auf den Judas stolz sein dürfte.“ Als in einem anderen Spiel Peter Czech einen Elfmeter von Gabriel Jesus abwehrte, kommentierte er: „Schon wieder wird Jesus von Petrus enttäuscht.“ Obwohl er dezidiert auf christliche Bilder und biblische Erzählungen zurückgreift, um die Vorgänge auf dem Spielfeld zu metaphorisieren, ist es die unmittelbare Relevanz dieser Worte für die Gestaltung des Spiels, die bei den Fans Anklang findet.[1]
Im Rahmen von Ballett der Massen wird Pitch Poetics: Die Moderation von Fußballspielen als Oraltur als Klanginstallation präsentiert, die Archivaufnahmen von Fußballkommentaren als Ausgangspunkt nutzt, um das Medium als eine Form der Oraltur zu untersuchen. Die Installation nimmt Momente in den Fokus, in denen die Moderation über die sachliche Beschreibung des Spiels hinausgeht. Diese poetischen Durchbrüche verwandeln entscheidende sportliche Momente in denkwürdige Episoden des kollektiven Gedächtnisses, wie etwa Thierry Gilardis emotionale Rede, in der er ausrief: „Oh Zinédine, oh Zinédine, pas ça, pas ça, pas ça Zinédine! Oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait!“ („Oh Zinédine, oh Zinédine, nicht das, nicht das, nicht das, nicht das, Zinédine! Oh nein, nicht das, nicht heute, nicht jetzt, nicht nach allem, was du getan hast!“) als Reaktion auf den Kopfstoß von Zinédine Zidane gegen Marco Materazzis Brust im Finale der Fußballweltmeisterschaft der Herren im Jahr 2006. Durch die Verwendung von Archivaufnahmen in verschiedenen Sprachen stellt die Installation im selben Zug die vielfältigen Formen der Moderation von Fußballspielen heraus.
Mit Archivmaterial von Herbert Zimmermann (Deutsch), Ernest Okonkwo (Englisch), Suo Chapele (Pidgin-Englisch), und Zachary Nkwo (Englisch) sowie einer Klanginstallation, die von Yara Mekawei basierend auf der Recherche von Comfort Mussa, Stella Nduka und Peter Okotor ermöglicht wurde.